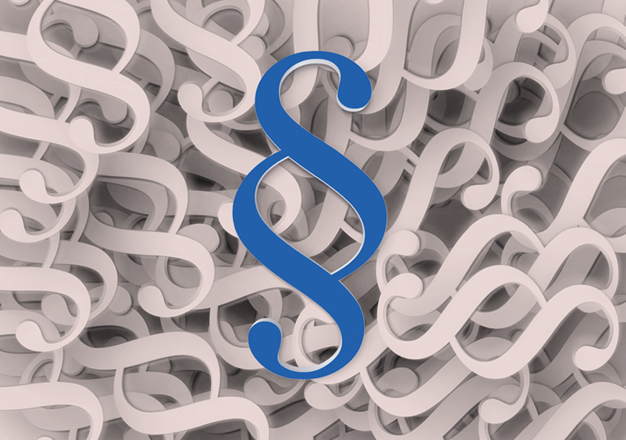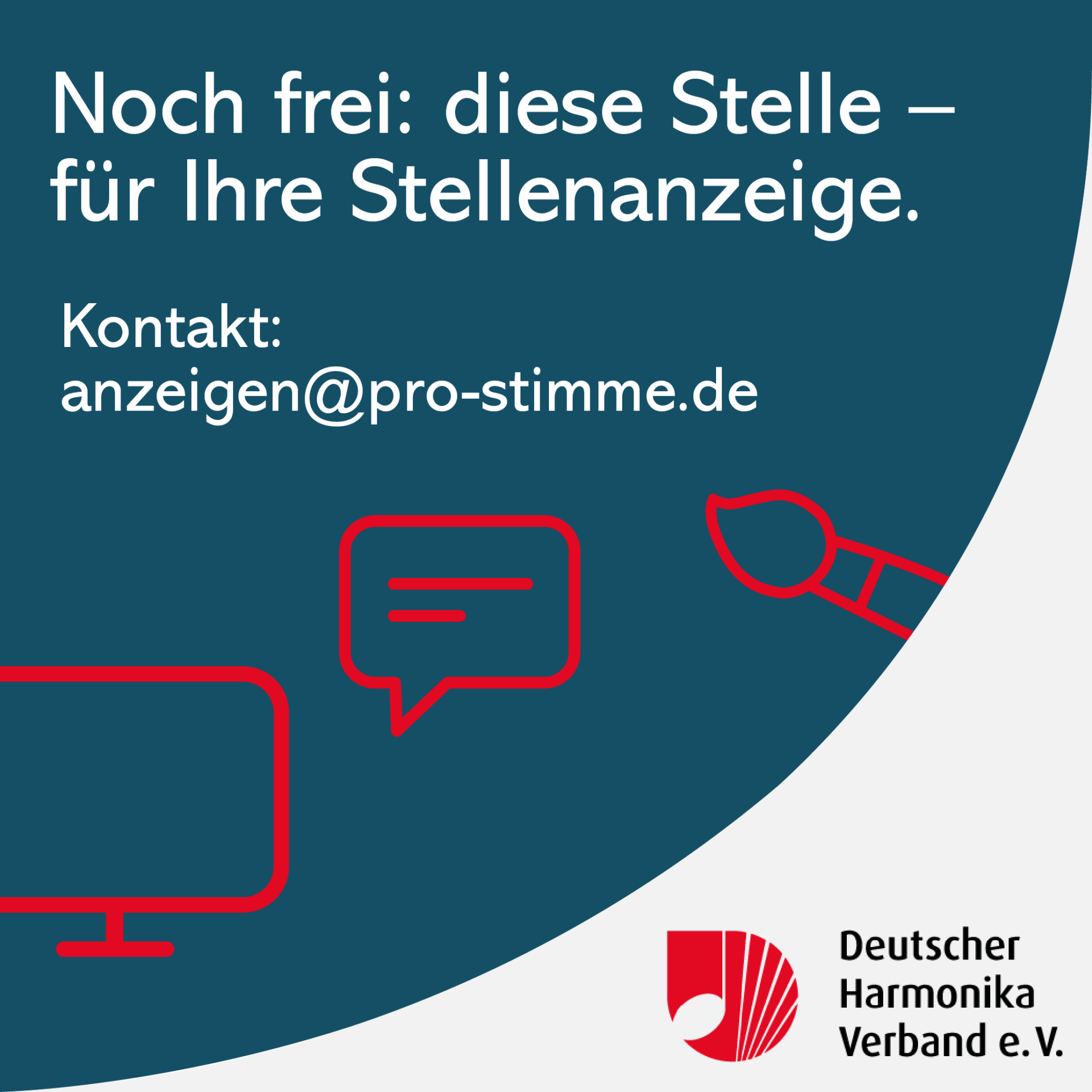Neue Vorgaben aufgrund des „Herrenberg-Urteils“?
Musikvereine, die Chorleiterinnen und Chorleiter oder Dirigentinnen und Dirigenten beschäftigen, bevorzugen in der Regel freie Beschäftigungsverhältnisse. Hierdurch wird ein normales Angestelltenverhältnis vermieden und der Verein muss sich nicht um die Abführung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen des Musikers oder der Musikerin kümmern. Bei der Formulierung und Ausgestaltung von derartigen Honorar-Verträgen kann es jedoch zu schwerwiegenden Fehlern kommen, deren Auswirkungen sich erst Jahre später zeigen.
Dies musste eine städtische Musikschule vor dem Bundessozialgericht schmerzlich erfahren. Das Gericht stellte in seinem Urteil fest, dass eine Musiklehrerin ihre Tätigkeit in der Musikschule seit dem Jahr 2000 nicht als freie Mitarbeiterin, sondern im Rahmen eines abhängigen Beschäftigungsverhältnisses ausgeübt habe. Dies führte zu der gerade nicht gewollten Konsequenz, dass für sie rückwirkend seit dem Jahr 2000 Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung besteht.
Was war passiert?
Gegenstand des Rechtsstreits war das Beschäftigungsverhältnis einer Musikschullehrerin bei einer Musikschule. Die Lehrerin hat mit der Musikschule in den Jahren 2000 bis 2015 mehrere Honorarverträge bzw. freie Mitarbeiterverträge geschlossen.
Kennzeichnend für die Verträge war jeweils u.a., dass ein Arbeitsverhältnis durch die Vereinbarung nicht begründet werden sollte. Die Musiklehrerin sollte die Tätigkeit persönlich ausüben. Das Honorar wurde jeweils gestaffelt nach Einzelunterricht oder Gruppenunterricht pro Unterrichtsstunde festgelegt. Die auf das Honorar entfallende Einkommensteuer musste die Lehrerin selbst abführen und für Krankenversicherung und Altersvorsorgeversorgung selbst Sorge tragen. Eine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall wurde ausgeschlossen, ebenfalls ein Urlaubsanspruch.
Die Musiklehrerin beantragte im Jahr 2014 die Feststellung ihres sozialversicherungsrechtlichen Status bei der Deutschen Rentenversicherung Bund. Die Rentenversicherung stellte nach der erfolgten Prüfung fest, dass die Tätigkeit der Musiklehrerin unter Berücksichtigung aller Merkmale ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis seit dem Jahr 2000 darstelle. In dem Beschäftigungsverhältnis bestehe daher Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sowie nach dem Recht der Arbeitsförderung. Hiergegen erhob die Musikschule Widerspruch und später Klage. In der von der Musiklehrerin erhobenen Revision beim Bundessozialgericht bekam diese in letzter Instanz recht, dass nicht eine freiberufliche Tätigkeit, sondern ein sozialversicherungsrechtliches Beschäftigungsverhältnis vorlag.
Wie begründete das Bundessozialgericht seine Entscheidung?
Das Gericht ist zu dem Schluss gekommen, dass eine abhängige Beschäftigung vorlag. Voraussetzung für eine solche sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist, dass der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber persönlich abhängig ist. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn der bzw. die Beschäftigte in den Betrieb eingegliedert ist und er bzw. sie dabei in Zeit, Dauer, Ort und Art der Ausführung einem umfassenden Weisungsrecht des Arbeitgebers unterliegt. Demgegenüber ist eine selbstständige und damit freie Tätigkeit vornehmlich durch das eigene Unternehmerrisiko, das Vorhandensein einer eigenen Betriebsstätte, die Verfügungsmöglichkeit über die eigene Arbeitskraft und die im Wesentlichen frei gestaltete Tätigkeit und Arbeitszeit gekennzeichnet. Ob jemand abhängig beschäftigt oder selbstständig tätig ist, richtet sich damit nicht allein nach dem schriftlichen Arbeitsvertrag, sondern nach dem Gesamtbild der Arbeitsleistung und hängt davon ab, welche Merkmale überwiegen.
Ob eine abhängige Beschäftigung nun vorliegt, ergibt sich also aus dem Vertragsverhältnis zwischen der Musikschule und der Musiklehrerin, und zwar so, wie es tatsächlich praktiziert worden ist. Maßgebend sind daher einerseits die getroffenen Vereinbarungen, andererseits aber auch die „gelebte Beziehung“. Wie bereits erwähnt führt nämlich allein der Wille oder die Bezeichnung eines Vertrags, diesen als Freien Mitarbeiter Vertrag ausüben zu wollen, nicht automatisch dazu, dass die Tätigkeit als selbständige Tätigkeit einzuordnen wäre.
Wie in vielen Fällen enthielt auch in dem verhandelten Fall die Tätigkeit der Musiklehrerin sowohl Merkmale der Selbständigkeit als auch Merkmale einer abhängigen Beschäftigung. Entgegen den getroffenen Vereinbarungen war die Musiklehrerin jedoch einem Weisungsrecht der Musikschule unterworfen und in einer ihre Tätigkeit prägenden Weise in die Organisationsabläufe der Musikschule eingegliedert. Das beschäftigungstypische Gepräge der Lehrtätigkeit der Musiklehrerin wurde insbesondere durch die Pflicht zur persönlichen Arbeitsleistung sowie die Festlegung auf bestimmte Unterrichtszeiten und Räume der Musikschule deutlich. Diese erstellte hinsichtlich der Unterrichtszeiten der Musiklehrerin einen Stundenplan und wies ihr die Unterrichtsräume zu. Das räumte der Musiklehrerin in Bezug auf den Ort der Tätigkeit keine und in zeitlicher Hinsicht nur insoweit Freiheiten ein, als unbelegte Räume zur Verfügung standen. Ihre Möglichkeiten, auf die zeitliche Gestaltung der Lehrtätigkeit Einfluss zu nehmen, gingen daher nicht über das auch abhängig Beschäftigten üblicherweise eingeräumte Maß an zeitlicher Gestaltungsfreiheit hinaus.
Die Eingliederung der Musiklehrerin zeigte sich auch daran, dass sie einen Unterrichtsausfall aufgrund eigener Erkrankung oder sonstiger Verhinderung zu melden hatte und ein Ausfallhonorar erhielt, wenn Schüler nicht zum Unterricht erschienen. Die Musiklehrerin unterhielt auch keine eigene betriebliche Organisation, hatte keine unternehmerischen Chancen und war keinem Unternehmerrisiko ausgesetzt. Vielmehr lag die gesamte Organisation des Musikschulbetriebs in den Händen der Musikschule. Sie stellte der Musiklehrerin die Räume und Instrumente kostenfrei zur Verfügung. Damit oblag allein der Musikschule die Pflege und Instandhaltung der Instrumente sowie die Ausstattung, Aufteilung, Reinigung und gegebenenfalls die Anmietung der Räume.
Wie können Vereine rechtssicher handeln?
Die Kriterien, die das Bundessozialgericht aufgestellt hat, gelten grundsätzlich für alle freien Beschäftigungsverhältnisse. Auch bereits zu Dirigentinnen und Dirigenten in Vereinen ergangene Entscheidungen spiegeln dies wider.
Eine Musterlösung für die Vermeidung nachteiliger Rechtsfolgen gibt es nicht, da es grundsätzlich auf den jeweiligen konkreten Einzelfall ankommt. Wesentliches Kriterium für eine abhängige Beschäftigung ist jedenfalls das Vorliegen eines Weisungsrechts des Vereins gegenüber seinem Dirigenten oder seiner Dirigentin. Schwierig wird es immer dann, wenn Mitgestaltungsbefugnisse des Dirigenten – sei es bspw. bei der Wahl von Ort und Uhrzeit von Proben oder der Auswahl der Musikstücke – ausgeschlossen oder eingeschränkt werden. Vielmehr müsste der Dirigent bspw. in der Lage sein, eigene Schülerinnen und Schüler akquirieren oder auf eigene Rechnung unterrichten zu können.
Der Ausschluss einer Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und von Urlaubsansprüchen sowie die vertraglich geregelte Pflicht des Dirigenten, Einkommensteuer abzuführen und für eine Krankenversicherung sowie Altersversorgung selbst Sorge zu tragen, sind dabei lediglich Ausdruck der Intention der Vertragspartner, eine selbstständige Tätigkeit zu wollen; unternehmerische Freiheiten sind damit nicht verbunden. Indizien für eine unabhängige, freie Beschäftigung sind demgegenüber das Recht des Dirigenten, auch eine Vertretungsperson zu Proben oder Aufführungen schicken zu können, oder auch die Möglichkeit, Aufträge des Vereins auch ablehnen zu dürfen. Der freie Mitarbeiter bzw. die freie Mitarbeiterin trägt im Wesentlichen ein Unternehmerrisiko und muss in der Regel wirtschaftliche Investitionen tätigen. Der Verein sollte daher bspw. vertraglich ausschließen, dass Noten und Instrumente auf Kosten des Vereins für den Musiker oder die Musikerin beschafft werden.
Nur wenn die vertragliche Gestaltung und das tatsächliche Verhalten der Beteiligten diese Punkte umsetzen, besteht Hoffnung, dass wirklich ein freies Beschäftigungsverhältnis vorliegt und Sozialversicherungsfreiheit besteht. Problematisch ist dabei, dass es nun eine erneute und breit diskutierte Entscheidung des Bundessozialgerichts gibt, deren Kriterien ebenso für die Beschäftigung von Dirigentinnen und Dirigenten oder Chorleiterinnen und Chorleitern gelten. Vereinsvorstände sind grundsätzlich verpflichtet, die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Amtes zu erfüllen. Insoweit müssen sie bei der Beschäftigung freier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unbedingt die rechtlichen Rahmenbedingungen beachten. Dies kann im Einzelfall jedoch kaum rechtssicher gewährleistet werden.
Zu empfehlen ist daher, bei der Vertragsgestaltung äußerste Vorsicht walten zu lassen. Der sicherste Weg ist hingegen, auf die Beschäftigung freier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verzichten und klassische sozialversicherungspflichtige Anstellungsverhältnisse zu wählen. Mindestens sollten die Vorstände jedoch zu Beginn einer neuen Beschäftigung eines freien Mitarbeiters oder einer freien Mitarbeiterin ein so genanntes sozialversicherungsrechtliches Statusfeststellungsverfahren durchführen. Dieses stellt sodann rechtsverbindlich fest, ob eine freie Tätigkeit oder ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vorliegt. Damit werden unklare Rechtslagen, langjährige Rechtsstreitigkeiten und Haftungsfragen bereits im Vorfeld vermieden.
Anzeige