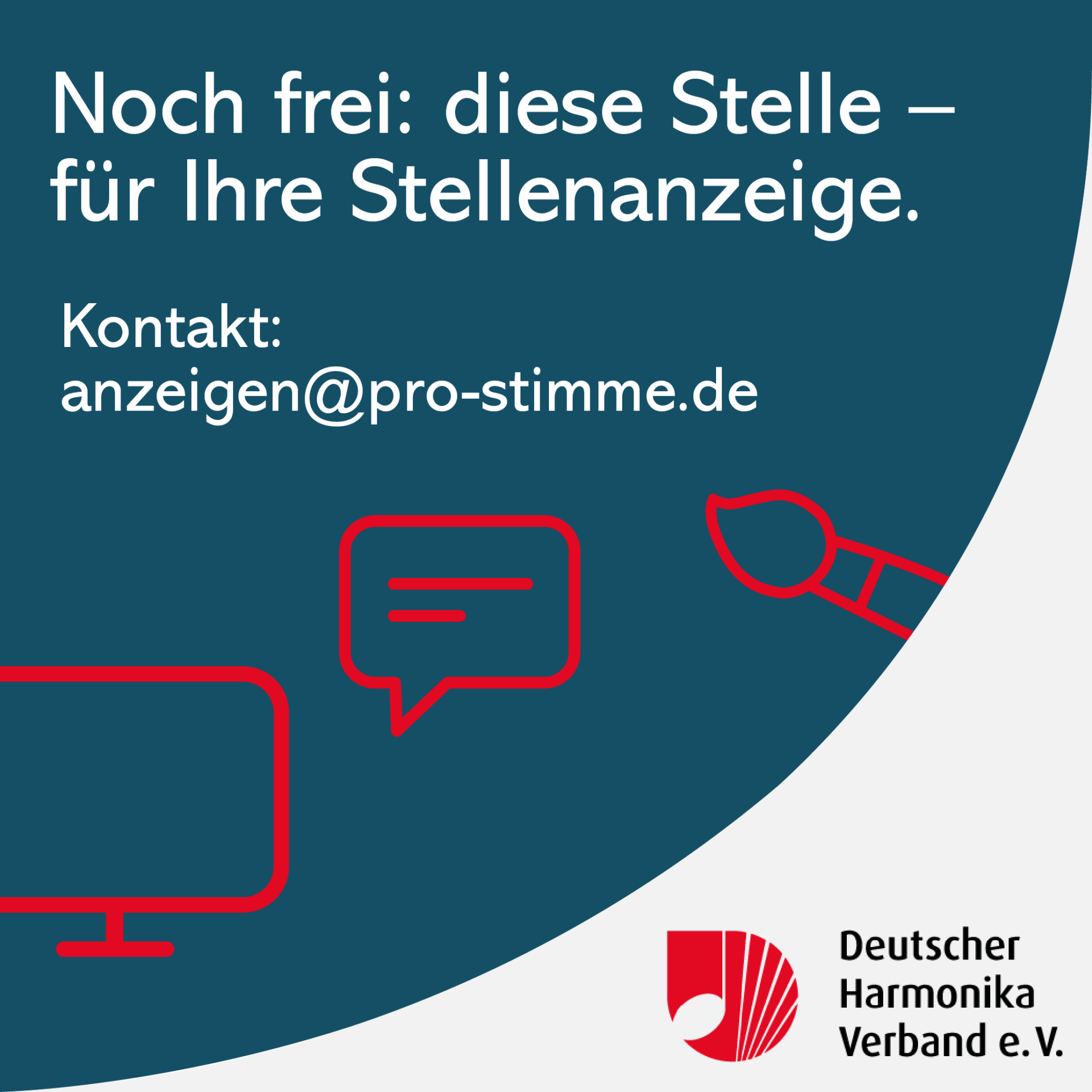Ein Konzertprojekt des Vereins Yehudi Menuhin Live Music Now Weimar
und der JVA Hohenleuben
Im Jahr 2022 realisierte das Akkordeonduo con:trust, bestehend aus Marius Staible und Daniel Roth, gemeinsam mit dem Verein Yehudi Menuhin Live Music Now Weimar und der JVA Hohenleuben das Musikprojekt »Kopfkino – Einsitzen in Hohenleuben«. Zusammen mit den Sängerinnen Luiza Ernst und Donata Burckhardt sowie neun Strafgefangenen der JVA Hohenleuben entwickelten sie ein gemeinsames Konzertprogramm, das zweimal zur Aufführung kam. HI-Redakteurin Daniela Höfele hat das Duo con:trust getroffen und mit ihnen über die Entstehung und Durchführung von »Kopfkino« gesprochen.
Als Stipendiaten von Yehudi Menuhin Live Music Now Weimar e.V. habt ihr 2022 gemeinsam mit dem Verein das Projekt »Kopfkino – Einsitzen in Hohenleuben« angestoßen. Wie kam es zu der Idee?
Der Verein Live Music Now hat es sich zur Aufgabe gemacht, Konzerte an Menschen zu bringen, die keine Konzerte besuchen können. Das sind Kindertagesstätten, Altersheime, Sterbehilfen, bestimmte Schulen, aber eben auch Gefängnisse. Im Rahmen dessen hatten wir schon ein paar Konzerte in Haftanstalten im Thüringer Raum gespielt. Einmal haben wir dann von einer Initiative gehört, durch die ein Band mit Gedichten und Texten von Gefangenen entstanden ist. So kam die Idee auf, solche Texte einmal zu vertonen. Am besten mit Livemusik. Man wollte einen Workshop anbieten, sich öfter treffen und die Aufgabenverteilung insofern gestalten, dass die Insassen Texte schreiben und eine gewisse musikalische Vorstellung mitbringen und wir das Ganze musikalisch umsetzen. Da brauchte man ein Instrument, das möglichst viele musikalische Genres abdecken kann – wie unsere Akkordeons. Und für die sprachliche Vermittlung hatten wir die Sängerinnen Luiza Ernst und Donata Burckhardt dabei [ebenfalls LMN-Stipendiatinnen, Anm. d. Red.]. Wir waren dann einige Male vor Ort in der JVA Hohenleuben, haben mit den Häftlingen gemeinsam an der Idee und Umsetzung gearbeitet und letztlich am Ende zwei Konzerte gespielt, eins im Gefängnis und eins in Greiz (Thüringen).
Welche Erwartungen, Wünsche und Befürchtungen hattet ihr im Vorfeld und inwiefern haben sich diese (nicht) bestätigt?
Wir haben uns ein paar Mal mit den Sängerinnen getroffen und überlegt, wie wir das Ganze aufziehen. Vor Ort gestartet haben wir, indem wir einfach ein bisschen Musik mitgebracht und viel von uns selber gezeigt haben. Und ein paar Schlaglichter geworfen, was im Rahmen der Möglichkeiten läge, ein paar Songs gespielt. Das war der Opener. Dann wollten wir die Teilnehmenden ermuntern, etwas zu schreiben. Das ist natürlich etwas sehr Persönliches – und das war auch eine unserer größten Befürchtungen. Was wollen sie da aufschreiben und was nicht, und wenn man sowas nicht gewohnt ist, fällt es einem ja auch nicht so leicht. Wir haben erstmal Musik gemacht und dann darüber gesprochen, was kreatives Schreiben ist und wie es geht, um sie zu ermutigen, aber auch um eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich gut versteht und miteinander umgehen kann. Das hat gut geklappt, was uns positiv überrascht hat.
Wie haben die Teilnehmenden der JVA Hohenleuben auf euch und das Projekt reagiert?
Die Grundstimmung war relativ gut, weil es einige Häftlinge gab, die das unfassbar ernst genommen haben und die uns von Anfang an emotional sehr nahe gekommen sind mit ihren Geschichten. Was wir erstmal verarbeiten mussten, aber was dem ganzen Projekt direkt von Anfang an sehr gut getan hat. Aber natürlich war das nicht bei jedem Teilnehmenden so, es gab auch ein paar, die das Ganze anfangs belächelt haben und gar nicht richtig mitmachen wollten. Aber dadurch, dass der Großteil motiviert dabei war, haben wir die Grundstimmung als überraschend gut empfunden.
War die Teilnahme komplett freiwillig?
Ja, da gab es einen Aushang, auf den hin sich die Insassen melden konnten. Manche wurden von anderen mitgezogen, das hat man aber dann auch gemerkt. Aber die, die wirklich Lust hatten, waren voll dabei – und es gab sogar zwei, drei Teilnehmende, die eher »mitgeschleppt« wurden, und erstmal eher schüchtern oder trotzig waren, aber sich nach und nach doch darauf eingelassen haben. Die sind richtig über sich hinausgewachsen und das war wirklich schön zu beobachten.
Was war für euch beide jeweils die größte Herausforderung bei diesem Projekt?
Daniel Roth: Es war viel Arbeit, und Hohenleuben ist von Weimar aus auch nicht direkt um die Ecke. Dadurch waren wir sehr viel unterwegs. Irgendwann hat es angefangen, dass die Teilnehmenden immer mehr geschrieben und uns richtig überhäuft haben mit ihren Texten. Da war dann die kreative Aufgabe, sich zu jedem etwas Passendes zu überlegen – oft sind Texte ja auch nicht so eins zu eins verwendbar, man muss kürzen oder umstellen. Das war nicht gerade wenig.
Marius Staible: Es war schon eine große Aufgabe, und wir haben ja auch die Musik komplett von Null entworfen. Also es gab keine Lieder, die wir neu vertextet haben, sondern ein Teilnehmender wollte zum Beispiel Mittelalter-Rock – okay, dann haben wir Mittelalter-Rock entworfen, obwohl wir da jetzt wirklich keine Experten sind. Dann gab es noch einen Hip-Hop- und einen Rap-Part, außerdem etwas Klassisches, ein Lied und Weiteres – und das war dann alles einerseits zu komponieren und arrangieren und andererseits auch auf die Bühne zu bringen. Man kann im Workshop aus Spaß Richtung Mittelalter-Rock gehen und darauf ein bisschen improvisieren. Das funktioniert. Aber wenn dann ein Konzert ansteht, mit Fernsehaufzeichnung und so weiter, dann muss es richtig gut und festgelegt sein. Und da eine Struktur dahinterzukriegen, so dass es wirklich auf die Bühne gebracht weden kann und ein ganzes Konzert füllt, mit Musik die aus dem Nichts entstanden ist, das war glaube ich die härteste Aufgabe. Das treibt einen dann ja auch ständig um im Alltag.
Daniel Roth: Genau, und manche Teilnehmende waren es gewöhnt, Musik zu machen, andere aber weniger. Für ein Konzert musste man natürlich wie gesagt eine Struktur vorgeben, was nicht jeder erwartet hat. »Du musst hier das machen, und mach das bitte immer so, und hier die Strophe«… Es gab einen afghanischen Teilnehmenden, mit dem wir ein afghanisches Lied entwickelt haben. Der konnte noch nicht so gut Deutsch, was es erstmal schwierig gemacht hat, richtig zusammen zu üben. Aber es war genial, dass das Repertoire dann auch diese Bandbreite hatte, von Rap bis zu afghanischer Volksmusik.
Marius Staible: Es wurde den Gefangenen eben komplett überlassen, welche Musikrichtungen gespielt werden. Und sie waren da im Gegenzug auch sehr kulant zu uns – wenn wir Mittelalter-Rock auf den Akkordeons mitbringen, ist das natürlich nicht das, was der Mittelalter-Rockfan vielleicht im ersten Moment erwartet hätte. Da fehlen dann die Gitarre und die Drums. Aber wir haben von den Teilnehmenden das Feedback bekommen, dass es immer genau das war, was sie wollten und vor allem das, was geholfen hat, um das Lied so rüberzubringen, wie sie es sich gedacht hatten. Das war sehr schön für uns, denn wir sind zwar nicht so limitiert wie manche anderen Instrumente, aber trotzdem haben auch unsere Möglichkeiten gewisse Grenzen. Aber dadurch, dass das am Ende des Tages doch so gut geklappt hat, hat man auch mal wieder gemerkt, was in so einem Akkordeon eigentlich steckt. Wie viel auf diesem Instrument geht, das ist echt spannend. Und wenn man zwei davon hat, dann geht nochmal mehr.
Daniel Roth: Das war schon echt eine gute Besetzung dafür. Ohne sich selbst loben zu wollen, aber ein Akkordeon ist ein Orchester, wie man immer sagt, und wenn man zwei hat, dann kann man eigentlich alles abdecken, was man möchte. Und zusammen mit Sprache, mit Gesang – da hatten wir alles, was wir gebraucht haben.
Das Finale des Projekts bildeten ja zwei Konzerte. Wie liefen diese ab?
Das meiste Sprachliche haben die Sängerinnen, Luiza Ernst und Donata Burckhardt, übernommen. Gleichzeitig haben wir versucht, die Gefangenen möglichst viel einzubinden mit Rap, Gesang oder auch gar Drums, aber einige wollten das nicht. Deshalb haben das meiste dann schon wir Musikerinnen und Musiker umgesetzt, aber alle Inhalte kamen von den Teilnehmenden.
Woran denkt ihr besonders gerne zurück?
Marius Staible: Das Abschlusskonzert war sehr schön. Da sind auch Tränen geflossen, das war sehr emotional, und wir sind alle nochmal ein Stück weiter zusammengewachsen. Alle haben T-Shirts bekommen, wir haben Fotos gemacht; schön war auch die Beziehung zwischen Wärter, Gefangenen und uns. Alle hatten Spaß, es war eine sehr erfrischende und aufmunternde Stimmung. Also am liebsten denke ich an dieses Konzert zurück.
Daniel Roth: Für mich waren es die Arbeit an sich und das menschliche Zusammenwachsen. Dass es möglich war, dass die Teilnehmenden sich abgeholt gefühlt haben und dass wir so offen miteinander umgehen konnten. Und ich glaube gefühlt zu haben, dass sie daraus auch etwas für sich mitgenommen haben und daran gewachsen sind. Das zeigt, es hat sich gelohnt.
Wie ging bzw. geht es weiter mit »Kopfkino« – gibt es die Chance auf eine Wiederholung oder Fortführung des Projekts?
Vom Projekt in 2022 bestehen durchaus noch Kontakte, manche der Teilnehmenden schreiben einfach manchmal, wie es ihnen geht und was sie so machen. Es gibt aber auch Planungen für eine Fortführung des Projekts, ja, es geht weiter. Wir müssen noch schauen, wie, wann und wo genau, aber dieses Jahr wird es ein erstes Zusammentreffen geben, in anderen Haftanstalten.
Herzlichen Dank für das Interview!
Weitere Informationen zum Duo con:trust: https://www.contrustmusic.com/
Weitere Informationen zum Verein Yehudi Menuhin Live Music Now Weimar e.V.: https://livemusicnow-weimar.de/
Anzeige