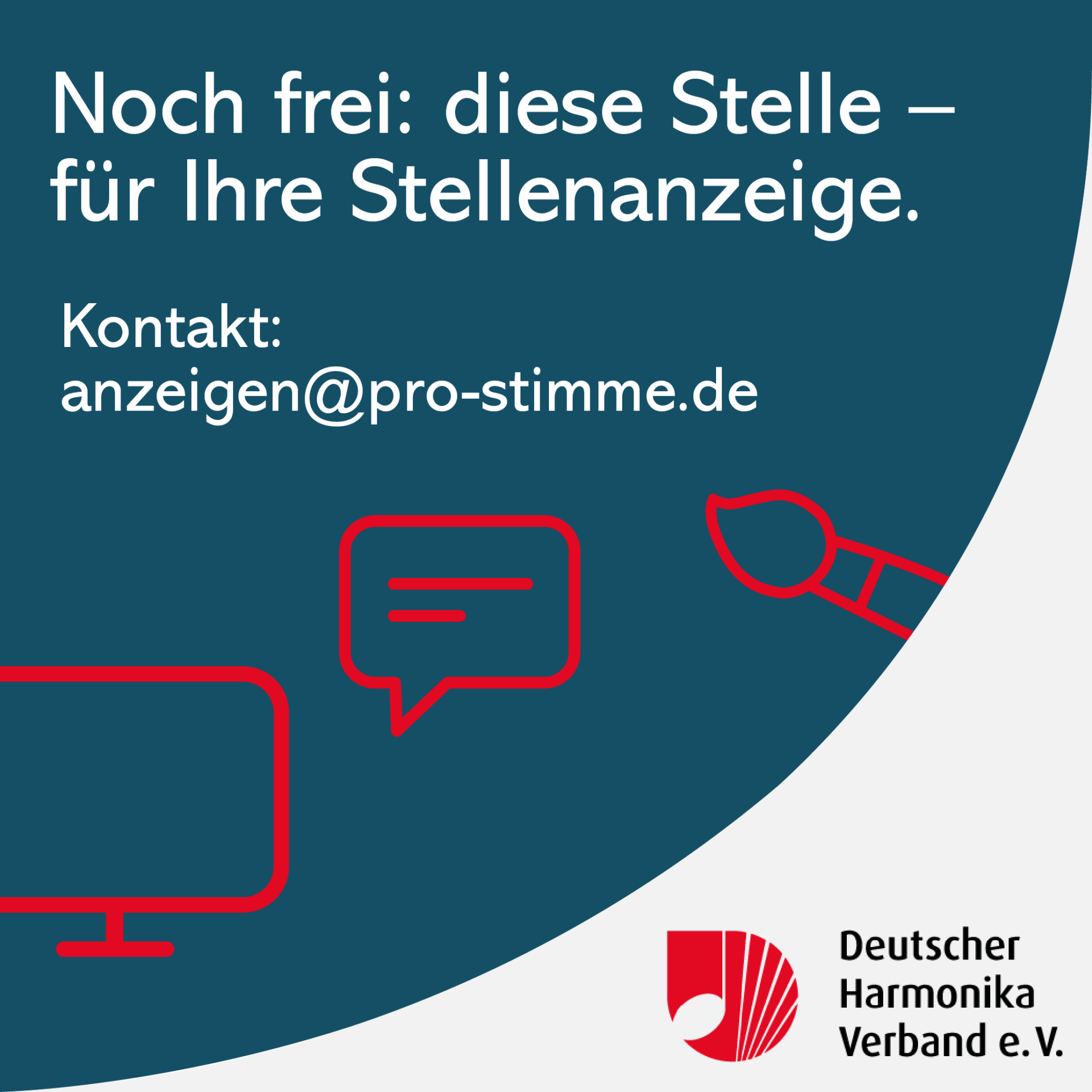Freiheitlich demokratische Grundwerte in der Arbeit von Vereinen
Manch eine gemeinnützige Organisation hat Sorge davor, dass sich Personen mit einer extremistischen Gesinnung in die Arbeit einbringen und so die Grundwerte der bisherigen Tätigkeit des Vereins unterlaufen. Im Folgenden sollen daher einige Überlegungen vorgestellt werden, wie ein Verein das eigene Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung stärken und so extremistischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Bestrebungen entgegentreten kann. Dabei ist klar, dass jede Organisation eigenständig für sich prüfen muss, ob etwaige Ideen mit den rechtlichen Rahmenbedingungen (vereins-, satzungs-, steuerrechtlich) zu vereinbaren sind (siehe dazu auch den Artikel von Nina Reipp in der aktuellen Ausgabe der Harmonika International).
Gestaltung einer Präambel
Die Präambel einer Satzung bietet eine gute Möglichkeit, um den Gremien eines Vereins Leitlinien mit auf den Weg zu geben, die im Einzelfall als Argumentationshilfe für die Auslegung von Satzungsbestimmungen herangezogen werden können.
Beispiel:
„Der Verein ist parteipolitisch und religiös neutral. Er vertritt den Grundsatz religiöser, weltanschaulicher und ethnischer Toleranz und Neutralität. Der Verein wendet sich entschieden gegen Intoleranz, Rassismus und jede Form von politischem Extremismus.“
Natürlich kann – je nach Vereinszweck – auch noch Bezug zu weitergehenden Werten genommen werden (z. B. zu Themen der Inklusion behinderter und nichtbehinderter Menschen und der Integration von Menschen mit Zuwanderungshintergrund, etc.).
Gestaltung des Aufnahmeverfahrens
Die Mitgliedschaft in einem Verein entsteht durch den Abschluss eines Vertrages. Im Rahmen der Grenzen, die durch das BGB bzw. durch die Vorgaben des Gemeinnützigkeitsrechts gezogen werden, gilt der Grundsatz der Vertragsfreiheit und der Vereinsautonomie. Es besteht grundsätzlich kein Recht auf die Aufnahme in einen Verein. Insofern kann erwogen werden, die Mitgliedschaft von weitergehenden Voraussetzungen abhängig zu machen, um so extremistischen Bestrebungen vorzubeugen. Dazu könnte etwa zählen:
- das Bekenntnis zu den Vereinsgrundsätzen,
- die Unvereinbarkeit der Mitgliedschaft im Verein mit Mitgliedschaften in anderen namentlich aufgeführten Organisationen,
- ein Vorschlagsrecht für die Mitgliedschaft durch Vereinsmitglieder als Bürgen.
Ausschluss von Vereinsmitgliedern
Sind Personen Mitglied im Verein geworden, so haben sie eine gefestigte Rechtsstellung. Ein Ausschluss von Vereinsmitgliedern ist an hohe Hürden gebunden. Dies erklärt sich zum einen daher, dass manch eine (Freizeit-)Aktivität sinnvoll der Mitgliedschaft im Verein bedarf. Zum anderen darf nicht jeder Konflikt über die Ausrichtung und Entwicklung eines Vereins dazu führen, dass kritische Mitglieder Gefahr laufen, von der Mitgliedschaft ausgeschlossen zu werden. Daher sind die Bedingungen, die zu einem Ausschluss führen können, in der Satzung klar und auch für den Nichtjuristen leicht nachvollziehbar zu regeln. Zwei Beispiele aus der Rechtsprechung mögen dies illustrieren.
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG, Beschluss vom 2.2.2023 – 1 BvR 187/21) hatte sich in einer Entscheidung mit einem Fall zu befassen, in dem ein Verein über folgende Satzungsregelung verfügte:
„Grundlage der Vereinsarbeit ist das Bekenntnis aller Mitglieder des Vereins zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. (…) Der Verein tritt allen extremistischen Bestrebungen entschieden entgegen. Der Verein bietet nur solchen Personen die Mitgliedschaft an, die sich zu diesen Grundsätzen bekennen. Mitglieder von extremistischen Organisationen gleich welcher politischen Ausrichtung, sowie Mitglieder rassistisch und fremdenfeindlich organisierter Organisationen oder religiöser Gruppierungen, wie zB der NPD und ihre Landesverbände, können nicht Mitglied des Vereins werden.“
Ein NPD-Parteimitglied wandte sich (erfolglos) gegen seinen Ausschluss aus dem Verein und gegen die dem Ausschluss zugrundeliegende Satzungsbestimmung. In seinem Beschluss hat das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich klargestellt, dass die Orientierung des Vereins an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und das Entgegentreten gegen extremistische, rassistische und fremdenfeindliche Bestrebungen im Hinblick auf die grundrechtlichen Wertungen (u. a. der Menschenwürde, des Gleichbehandlungsgrundsatzes) nicht zu beanstanden seien. Gleichzeitig hat das Bundesverfassungsgericht ausgeführt, dass es sich in dem konkret zu entscheidenden Fall nicht „um eine missliebige Parteimitgliedschaft eines Vereinsmitglieds“ handele, sondern dass dem Beschwerdeführer „als Landesvorsitzendem die verfassungswidrige Zielsetzung der NPD zuzurechnen“ sei. Hier zeigt sich, dass im Einzelfall eine Differenzierung zwischen der Mitgliedschaft im Verein einerseits und politischen Einstellungen, die die Vereinsmitgliedschaft nicht berühren andererseits, erforderlich ist. Das Bundesverfassungsgericht verweist zudem darauf, dass die Beeinträchtigung der Freizeitgestaltung durch den Vereinsausschluss „moderat“ sei.
In einer Entscheidung des Amtsgerichts Hannover (Urteil vom 14.02.2019 – Az. 554 C 1620/18) ging es um tätliche Auseinandersetzungen auf einem Parkplatz von Mitgliedern zweier Fußballvereine im Vorfeld zu einem Fußball-Bundesligaspiel zwischen den Profiabteilungen der jeweiligen Vereine (sog. Drittplatz-Auseinandersetzung).
In diesem Fall sah das Gericht den Vereinsausschluss als nicht hinreichend begründet an. So sei etwa in dem Verhalten des betroffenen Vereinsmitglieds kein Verstoß gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung ersichtlich: „Die freiheitlich demokratische Grundordnung ist der unveränderliche Kern der Verfassung, dem Grundgesetz (GG), aber nicht die Summe aller Gesetze und allen Rechts. Ein Bekenntnis hiergegen erfordert zumindest auch eine verbale oder anderweitig offenbare Ausrichtung gegen diese. (…) Selbst die Begehung von Straftaten enthält für sich kein Bekenntnis oder Bestrebung gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung.“
Einige mögliche Fehlerquellen
Die Beispiele machen deutlich, dass der Ausschluss eines Vereinsmitglieds im Einzelfall gut vorzubereiten und zu begründen ist. Das gilt umso mehr, als das betroffene Mitglied die Möglichkeit hat, den Ausschluss gerichtlich überprüfen zu lassen. Daher sollen hier einige Fragen aufgelistet werden, die zur Vorbereitung des Ausschlusses hilfreich sein können:
- Welches Organ ist für den Ausschluss des Vereinsmitgliedes zuständig?
- Ist der Ausschluss als Tagesordnungspunkt für die entsprechende Gremiensitzung hinreichend angekündigt worden (vgl. auch § 32 Abs. 1 Satz 2 BGB)?
- Ist dem betroffenen Mitglied rechtliches Gehör gewährt worden?
- Handelt es sich bei dem im Ausschließungsbeschluss genannten Ausschlussgrund um einen solchen, der auch statuarisch festgelegt ist?
- Sind die Umstände, aus denen heraus sich die Unzumutbarkeit der Fortführung des Mitgliedschaftsverhältnisses ergibt, bereits im Ausschließungsverfahren eindeutig und konkret bezeichnet und in gerichtlich nachprüfbarer Weise festgestellt worden?
Auch hier möge anhand einer gerichtlichen Entscheidung veranschaulicht werden, wie sensibel die Durchführung eines Ausschlussverfahrens ist (AG Bonn, Urteil vom 11.09.2018 – Az. 114 C 140/18):
Die Satzung des Vereins enthielt die Bestimmung:
„(…) Die Mitgliedschaft endet mit der schriftlichen Bekanntgabe der außerordentlichen Kündigung und der Gründe gegenüber dem Mitglied“.
Im Kündigungsschreiben selbst wurde ausgeführt:
„Ihr bisheriges Verhalten, zu dem Sie bereits angehört worden sind, ist mit der Satzung und dem Selbstverständnis des Reservistenverbandes nicht vereinbar.“
Das Gericht sah diese Formulierung als „eine Leerformel mit als solchem nichtssagenden Inhalt.“ Zudem habe der Verein weder nachvollziehbare Indizien noch Beweise vorgebracht: „Er stützt sich seinerseits auf Informationen Dritter und spricht deshalb – insofern zu Recht vorsichtig – stets davon, der Kläger „solle“ Mitglied in den diversen Vereinigungen (…) sein. Ob ein bloßer Verdacht ausreicht und inwiefern dieser zumindest zu konkretisieren und zu belegen ist, kann wegen der bereits formell unwirksamen Kündigungserklärung dahinstehen.“
Fazit
Die Ausführungen machen deutlich, dass es für (gemeinnützige) Vereine nicht leicht ist, sich vor extremistischen Tendenzen zu schützen. Das ist einerseits nachvollziehbar, da nicht über jeder Auseinandersetzung in einem Verein das Damoklesschwert eines möglichen Vereinsausschlusses schweben soll und nicht jede Betätigung außerhalb des Vereins als vereinsschädigendes Verhalten qualifiziert werden kann. Es macht andererseits deutlich, wie wichtig es für Vereine ist, die eigene Satzung daraufhin zu überprüfen, ob sie hinreichend ausgestaltet ist, um eigene Werte und darüberhinausgehend die Werte der freiheitlich demokratischen Grundordnung zu schützen. Oder – mit den Worten Carlo Schmids: „Es braucht den Mut zur Intoleranz denen gegenüber, die die Demokratie gebrauchen wollen, um sie umzubringen.“
Über den Autor
Prof. Dr. Burkhard Küstermann, LL.M., Professor für Rechtswissenschaften an der Hochschule Bielefeld, daneben freiberuflicher Berater gemeinnütziger Organisationen. Herr Küstermann sammelte umfassende Berufserfahrung im Non-Profit-Bereich durch seine langjährige Tätigkeit beim Bundesverband Deutscher Stiftungen. Inhaltlich befasst sich Herr Küstermann neben sozialrechtlichen Fragestellungen insbesondere mit Themen des Gemeinnützigkeitsrechts sowie mit den rechtlichen Rahmenbedingungen ehrenamtlichen Engagements.
In Hinblick auf die Vielfalt der individuellen Fallgestaltungen, die im Vereinsrecht vorkommen, kann eine Haftung für die gegebenen Auskünfte im Hinblick auf konkrete Einzelfälle nicht übernommen werden.
Anzeige